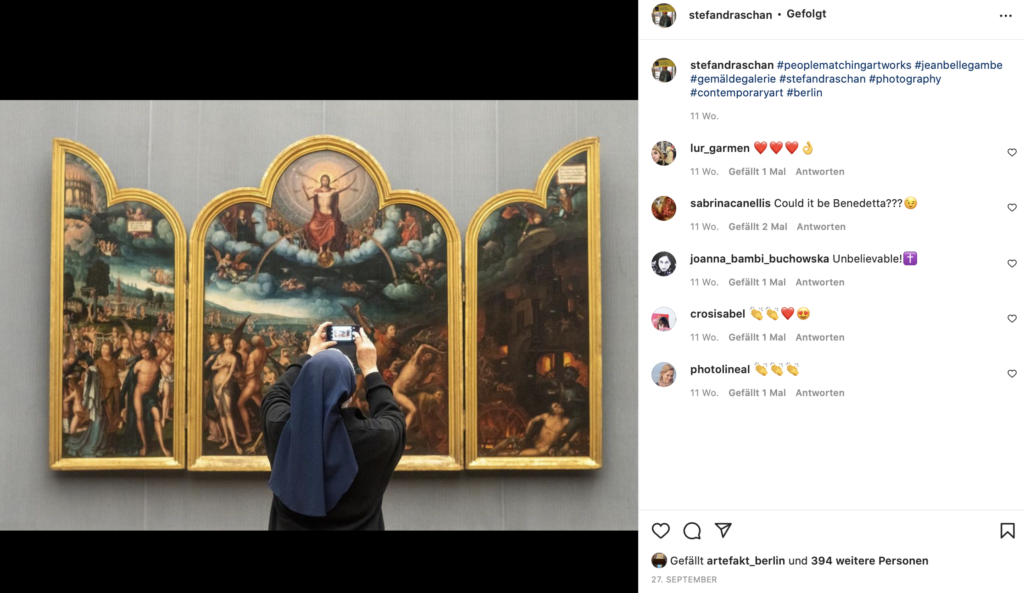Das Stendhal-Syndrom und die Selbstorganisation ästhetischer Rezeption
Wer erinnert sich nicht an Filme, die ihn zutiefst berührt haben? Nach denen es nötig war, eine Stunde im Park nachzudenken und die Berührung abklingen zu lassen? Es mögen ganze Filme sein (bei mir war es L‘Atalande von Jean Vigo), vielleicht auch nur einzelne Szenen (wie bei mir der finale Tanz der Titelfigur mit dem englischen Fremden in Alexis Zorbas, nach einer Abenteuerfahrt durch die Welt der Affekte, durch phobos und eleos gleichermaßen). Bei manchen ist die Bereitschaft, sich auf Filme einzulassen, sich fallen zu lassen und aufzugehen im Nachvollzug der Erzählung, ausgeprägter als bei anderen; manche vermögen solche Formen des Intensivsterlebens auf der Folie musikalischer Stücke zuzulassen. In medienautobiographischen Erzählungen stoßen wir immer wieder sogar auf Werke, von denen die Erzähler sogar langfristige Auswirkungen auf das eigene Selbstbild vermuten. Vielleicht ist diese Art des Zueigenmachens aber auch eine der Tiefenfunktionen der Kunst im Allgemeinen…
Doch stoße ich in meinen vielen verstreuten Lektüren über eine Form der Kunstanrührung, die mir fremd ist. Sie nennt sich Stendhal-Syndrom. Ihren Namen erhielt es nach dem französischen Schriftsteller Marie-Henri Beyle, der unter seinem Pseudonym M. de Stendhal (oder nur kurz: Stendhal) bekannt wurde. Er lebte nach den Napoleonischen Kriegen in Mailand, wurde dort zum Literaten. Als Kunst- und Kulturinteressierter machte er 1817 eine Reise durch die italienischen Hauptstädte der Kunst und veröffentlichte einen Reisebericht (Promenades dans Rome, Naples et Florence en 1817, der 1826 auch als Buch erschien (Rome, Naples et Florence [Paris: Delaunay 1826]). Er war Bildungsreisender, wie andere seiner Zeit auch. Doch ihm geschah etwas Besonderes – er kam als Kunstinteressierter nach Florenz und war, noch vor der Ankunft in der italienischen Stadt, von seinen Gefühlen bereits in eine Art von Ekstase versetzt worden. Er besichtigte die Basilika Santa Croce, die Grabeskirche von Michelangelo, Macchiavelli und Galileo – und reagierte in einer so extremen Art und Weise, dass sie Geschichte machen sollte, allerdings nicht in der Literatur, sondern in der Medizingeschichte:
„Ich befand mich in einer Art Ekstase bei dem Gedanken, in Florenz und den Gräbern so vieler Großen so nahe zu sein. zu sein. Ich war in Bewunderung der erhabenen Schönheit versunken; ich sah sie aus nächster Nähe und berührte sie fast. Ich war auf dem Punkt der Begeisterung angelangt, wo sich die himmlischen Empfindungen, wie sie die Kunst bietet, mit leidenschaftlichen Gefühlen gatten. Als ich die Kirche verließ, klopfte mir das Herz; man nennt das in Berlin Nerven[anfall]; mein Lebensquell war versiegt, und ich fürchtete umzufallen.“[1]
Natürlich gehört Stendhals Bericht in den Horizont der Geisteshaltungen und Geschichten seiner Zeit. Und es drängt sich mir auf, ihn als Ausdruck einer Hypersensitivität des 19. Jahrhunderts anzusehen, als gehöre er in eine letztlich bourgoise Haltung der Kunst gegenüber und sei Teil einer besonderen Programmatik der Kunstbetrachtung der Zeit. Schon Stendhals eigene Überlegungen zielten darauf ab, in der Kunstkritik eine „poetische Formung des sinnlichen Erlebens einer künstlerisch gestalteten Wirklichkeit“ zu zeigen, eine „ganzheitliche Betrachtung“ zu ermöglichen, Schönheit als Glücksversprechen wahrnehmbar zu machen und im Schönheitsrausch den Betrachter zu einem Ganzheitserleben jenseits allen Wissens und aller Wissenschaftlichkeit der Haltung zur Realität zu führen (Drost 2017, 41f).
Gerade von Künstlern ist immer wieder berichtet worden, dass sie manchmal syndromatisch nicht nur auf die Begegnung mit Kunst, aber auch im eigenen Kunstschaffen reagierten.[2] Ein immer wieder erwähntes Beispiel aus der Geschichte des Syndroms ist Dostojewski, der bekanntermaßen schrecklich aufgeregt war, als er das berühmte Gemälde des toten Christus von Hans Holbein im Basler Kunstmuseum („Der Leichnam Christi im Grabe“) sah, sodass seine schwangere Frau befürchtete, er würde einen seiner epileptischen Anfälle bekommen; in dem ein Jahr später geschriebenen Roman Der Idiot (1868/69) sagt die Hauptfigur Fürst Myschkin, dieses Bild habe die Kraft, den Glauben auszulöschen (Amâncio 2005).
Eine Haltung, die ich in meiner Lektüregeschichte intuitiv mit dem Goethe‘schen Werther beginnen lasse: Eine Geschichte über eine Gruppe junger Leute, die sich in eine künstliche Bereitschaft versetzen, von Werken der Kunst im Innersten berührt zu werden. Es ist nicht die Macht der Kunst (im Werther gehtʼs wohl vor allem um Lyrik), die den Rezipienten überwältigt und der er machtlos ausgesetzt ist – nein, es sind Spätpubertiertende, die es erwarten, überwältigt zu werden, passiv erlebte Hingabe zu erfahren. Es ist nicht die Gewalt der Kunst, die schon bei der Erwähnung des Namens „Klopstock“ Tränenströme auslöst, sondern ein subkulturelles Nutzungsmuster, in dem der Dichtername zu einer Sigle wird, die für eine behauptete Intimität der Rezeption steht. Natürlich weiß ich um den in der Literatur so oft erwähnten Werther-Effekt, demzufolge eine ganze Reihe jugendlicher Leser des Romans den Freitod gesucht haben, nach dem Modell der Romanhelden. Natürlich weiß ich, dass sich das Muster in der Geschichte jugendlicher Medienrezeption wiederholt und beispielsweise auch nach James Deans Tod weltweit zu verzeichnen war. In der Analyse derartiger Jugendtode fragt man nach allzu starker Identifikation, nach dem abwesenden Realitätsprinzip, dem Überhandnehmen imaginärer Verbindungen zu Figuren der Kunst.
Natürlich weiß ich, dass ich Werther-Effekt und Stendhal-Syndrom nicht in eins setzen kann. Letzteres ist ein Ausfluss „erlebter Passivität“; ersteres dagegen geht weit über die Kunstbetrachtung hinaus, ist auf Bindung an Idole angewiesen, die in Freitod oder Selbstverletzung als parasoziale Adressaten oder gar als Vorbilder genutzt werden. Werther-Effekte sind aktive Formen der Selbstgestaltung, keineswegs Reaktionen auf die Aktualgenese von Kunstwerken.
Eines wird aber meist in der Werther-Analytik übersehen: So überkandidelt die Figuren des Romans bei genauerer Betrachtung auch sind, so sind sie als Leser der Kunst nicht wehrlos ausgeliefert, sondern sie erwarten die Kunstüberwältigung, und man darf schlussfolgern, dass diese nicht von den Werken, sondern von den Rezipienten selbst ausgeht. Es ist ein Grundzug der Hysterie, der allenthalten spürbar ist (und der auch manchen Formen extremer Fanbegeisterung wie der viel späteren „Beatlemania“ und anderen „*manias“ innewohnt). Dass Ken Russell das Wortbildungsmuster im Titel seines Films Lisztomania verwendete und die hysterische Begeisterung der Musikfans in das 19. Jahrhundert verlängerte, das Phänomen als ebenso übersteigerte wie sexuell getönte Fan-Bindung entfaltete, zog noch in den 1970ern manche Empörung auf sich; dass er damit aber auf einen stillschweigenden Kontrakt hindeutete, der zwischen Musikern und zumindest Teilen seines Publikums auf Erregungszustände der Zusehenden und -hörenden ausgerichtet war, wurde meist übersehen.[3]
Überwältigungserwartung also als Ausdruck eines Ich-Entwurfs, als ausgestellte Attitüde? Und – gleichgültig, ob die Überwältigung in der Kunstrezeption erreicht wird oder nicht – die die „Überwältigung-Erzählung“ als formelhafte Ausdrucksform in der Kommunikation zwischen Fans hervorbringt?
Stendhals Beschreibung ist überaus präzise: Schon vor dem Besuch Flozenzʼ erfasst ihn eine „Ekstase“ (der Kunsterwartung, oder genauer: der Wirkung der Kunstwerke auf sich selbst). „Versunkenheit“, um in jenen Zustand der Berührung mit dem „Erhabenen“ zu erreichen, der im Kunstwerk aufbewahrt ist und durch die Aneignung des Kunstwerks zu Eigenem gemacht werden kann. Und zugleich zu etwas gegen die Realität abgeschirmtem Eigenen, das ganz der Begegnung des Ichs mit dem Kunstwerk vorbehalten ist.
Doch sind Stendhal-Syndrom, Werther-Effekt und ähnliche Sonderfälle der Kunstrezeption mit jener „Berührung“, die ich eingangs dieser Überlegungen erwähnte, in Zusammenhang zu bringen? Immerhin erwähnt Stendhal in dem kurzen Text, dass er von Berliner „Nerven“ angegriffen gewesen sei. Tatsächlich ist das Stendhal-Syndrom genauer gefasst, weit über eine Beeindruckung auf einer tiefen emotionalen und kognitiven, vielleicht auch moralischen Ebene hinaus. Die italienische Psychologin Graziella Magherini – sie war damals Leiterin der psychologischen Abteilung des Florentiner Krankenhauses Santa Maria Nuova – skizzierte 1989 erstmals wissenschaftlich die Symptomatik des Stendhal-Syndroms.[4] Sie war es auch, die der psychosomatischen Störung ihren Namen gab.[5]
Magherini stützte sich auf mehr als 100 Fälle, die in ihr Krankenhaus eingewiesen worden waren. Über die rein subjektive Beobachtung (wie in Stendhals Reisebericht) hinaus betonte sie vor allem die somatischen Effekte, die in der Begegnung mit den Kunstwerken ihren Ausgang genommen hatten. Und sie klassifizierte das Phänomen eindeutig als Krankheit, die sie in drei Gruppen einteilte:
(1) Denk- und Wahrnehmungsstörungen, Halluzinationen und wahnhafte Stimmungen, Wahnvorstellungen, Schuldgefühle:
(2) Affektstörungen, Allmachtsphantasien, existenzielle Angst, Erkenntnis der eigenen Bedeutungslosigkeit;
(3) Panikattacken, Herzrasen, Atemnot, Ohnmachtsanfälle, erhöhter Blutdruck, Bauchschmerzen, Krämpfe.
Bei einzelnen Patienten traten die Störungen manchmal gleichzeitig, manchmal aber auch nur einzeln auf. Ein Muster war nicht erkennbar. Im nahezu allen Fällen klangen die Symptome schnell wieder ab und hinterließen keine Langzeitschäden.
Eine vorübergehende Störung der Befallenen? Für die Behandlung empfiehlt sich, wie Bamforth (2010) lakonisch notiert: „ Getting out of Italy as soon as possible and back to mundane reality“! Das Syndrom hinterlässt auch keine bleibenden seelischen Störungen, wie mancherorts behauptet. Eine Ausnahme ist offenbar ein 72jähriger Künstler, der in Florenz eine paranoide psychotische Episode erlebte, die seitdem mehrfach wieder auftrat (Nicholson […] 2009).
Magherinis Beschreibung ihrer Fallgruppe wurde schnell international bekannt – als Phänomen der Psychiatrie (es wurde allerdings auch nach der 4. Ausgabe des das APA-Handbuchs der psychischen Störungen [1994] nicht erwähnt, findet sich heute aber in vielen Wörterbüchern der Medizin und Psychologie) wie aber auch der Kunstpsychologie. Die Menge der publizierten Falluntersuchungen blieb aber ebenso übersichtlich wie die Reflexion über die rezeptionspsychologischen und -ästhetischen Grundlagen der Extremreaktion, in beiden akademischen Disziplinen.
Aufschlussreich waren Magherinis Untersuchungen zur soziobiographischen Beschreibung der Betroffenen, denen sie das Stendhal-Syndrom diagnostizierte: Es waren vor allem weibliche, ledige Touristen (und nicht Einheimische), alleinreisend, meist zwischen 26 und 40 Jahre alt und fast alle aus den USA oder Mittel- und Nordeuropa stammend; Italiener erwiesen sich als immun gegen das Überhandnehmen von Kunsteindruck. Als klar erkennbare Risikofaktoren werden neben dem Alter und dem Geschlecht heute der Familien- und der Bildungsstand und das subjektiv erlebte Stress-Niveau angesehen (Ayak 2019); auch das Alleinleben, die Nähe des Endes der (Bildungs-)Reise und die religiöse Erziehung (bzw. allgemeiner: die Religiösität der Befallenen) werden vielfach genannt (Sanchez […] 2018).
Noch ein zweiter Befund fiel auf: Mehr als 50 Prozent der Patienten waren vorher bereits einmal in psychologischer Behandlung gewesen. Aus welchen Gründen sie ärztlichen Rat gesucht hatten, ist allerdings unbekannt. Welche Rolle spielen Prädispositionen? Und: Kannten die Befallenen das Syndrom schon vor den Symptomen?
Es bleiben einige andere Rätsel – warum das Stendhal-Syndrom so gehäuft in Florenz auftritt z.B., und dort auch nur in den Museen. Warum nicht in anderen Sammlungen wie den Louvre! Zwar wurde Dostojewski im Basler Kunstmuseum imaginär infiziert, doch ist er eine der wenigen Ausnahmen. Manchmal wird heute sogar von der Florentinischen Krankheit gesprochen. Ianick de Oliveira (2020) suchte jüngst eine Herzattacke zu rekonstruieren, die ein toskanischer Mann angesichts der „Geburt der Venus“ von Botticcelli in den Uffizien erlitten hatte; der Mann wurde gerettet, weil der Rettungswagen früh genug eintraf. De Oliveiras Untersuchung endet mit Fragen über die so undurchdringlichen Zusammenhänge zwischen ästhetischer Erfahrung und körperlichem Wohlbefinden sowie der Rolle, die besondere Kunstwerke darin spielen.
Die Suche nach einer Ätiologie des Syndroms endet in allen vorliegenden Untersuchungen in Ursachen, die nur kulturwissenschaftlich zu erfassen sind. Es sind (nicht nur im Ensemble der Florentiner Fälle) Touristen, die von einer Art Schwindel und einem erlebten Selbstverlust erfasst werden. Mehrfach ist in den Interpretationen des Stendhal-Syndroms die Welterfahrung des Reisenden als bedingender Einflussfaktor des Syndroms benannt worden. Reisen – und insbesondere solche zu den großen Orten der europäischen Kunstproduktion oder -exposition – sind vielfach motiviert durch das Vorhaben, die Objekte der Kunstgeschichte in Augenschein zu nehmen, in der oft nur diffusen Hoffnung, in der Begegnung mit dem Werk die Andersartigkeit des Kunsterlebnisses ebenso zu erfahren wie dessen erhöhte Intensität (Datta 2017, 68f). Selbstbegegnung also als Motivation der Reise (durchaus verbunden mit der eingangs erwähnten „Überwältigungserfahrung“), als letztlich narzisstischer Impuls; selbst dass die Reisenden so oft erst am Ende der Reise vom Syndrom erfasst werden, wie Margherini notierte, kann damit in Verbindung gebracht werden, als Versuch, die ersehnte Erfahrung intensivster Kunstbeeindruckung noch vor der Heimreise zu machen.
Zwar gehen manche Neuroästhetiker davon aus, dass es universale, neurologisch identifizierbare Elemente der ästhetischen Reaktion gebe – körperlich manifeste Mechanismen wie die Simulation von Handlungen, physiologisch nachweisbare Emotionen und körperliche Empfindungen (Freedberg/Gallese 2007). Sie alle deuten auf eine tiefe körperlich-empathische Aktivität der Aneignung visuell dargebotener Kunstwerke hin. Allerdings interagieren die somatischen Reaktionen mit historischen, sozialen, kulturellen und persönlichen Bedingungsfaktoren. Das Syndrom lässt sich diagnostizieren, aber seine Herleitung ist komplex, keinesfalls auf simple Kausalverknüpfungen zu reduzieren. Im besonderen Falle des Stendhal-Syndroms sind es Faktoren, die erst mit den kunstreligiösen Programmatiken des frühen 19. Jahrhunderts, mit der Praxis der kulturgeschichtlich motivierten Bildungsreise der gleichen Zeit, der Praxis des Tourismus, individuellen Bildungsgeschichten und ähnlichem aufkamen. Es mag am Ende eine medizinische und psychiatrische Tatsache sein; von seinen Bedingungen her ist es aber vor allem ein kulturhistorisches Symptom.
Manchmal wird von der kunstpsychologischen Dimension des Phänomens abgeblendet und der Ort der Reise als Bedingung für die so besondere Erfahrung des Stendhal-Syndroms geltend gemacht. So spricht man neben dem „Florenz-“ auch vom „Indien-“ oder „Island-Syndrom“ (Airault 2015), man stößt auf das „Paris-Syndrom“, das vorzugsweise japanische Touristen in der französischen Hauptstadt befällt (Viala […] 2004), auf das „White House Syndrome“ oder auf das „New-York-Syndrom“. Gerade letzteres steht gar nicht im Kontext der Kunstrezeption, ist auch keineswegs mit den eben beschriebenen psychosomatischen Effekten, sondern bezeichnet Existenzängste und Depressionen, die vor allem Neu-New-Yorker plagen, die nach dem Umzug feststellen, dass die Hoffnung, vor allem in Kreativ-Berufen schnell Karriere machen zu können, in der riesigen Stadt enttäuscht werden (Goleman 1984). Schon dieses Beispiel verdeutlicht, dass es Stadtbilder sind, stereotype Vorstellungsbilder über urbane Lebenswelten, die in Erwartungen, ja in Lebensentwürfe einmünden, die handlungsleitend für das Subjekt werden können – die selbst aber aus den Entwürfen städtischen Lebens resultieren, wie sie in Medien entworfen werden. Ein anderes Beispiel, in dem es nicht um Kunstgenuss am besonderen Ort geht, wohl aber um eine Interaktion mit vorlaufender Kunstrezeption: Unter dem Rubrum „Venedig-“ oder „Lagunen-Syndrom“ suchten Stainer und seine Kollegen (2001) die Stadt als Anziehungspunkt für gebildete Suizidale – sie griffen auf 51 dokumentierte Freitode zwischen 1988 und 1995 zurück – zu identifizieren; ob es allerdings einen Zusammenhang der Suizide insbesondere mit Viscontis Morte a Venezia geben könnte, bleibt unangesprochen).
Auch wenn es oft in Zusammenhang mit dem Stendhal-Syndrom gebracht wird, ist auch das Jerusalem-Syndrom von anderer Art: Symptomatologisch als „akute und vorübergehende psychotische Störung“ klassifiziert, bezeichnet es eine vorübergehende Identifikation der Erkrankten mit prominenten, heiligen Personen aus dem Alten oder Neuen Testament (v.a. Mose und König David aus dem AT, Jesus, Maria und Johannes der Täufer aus dem NT). Es sind wohl um die 100 Fälle, die jährlich diagnostiziert werden. Auffallend ist, dass Männer männliche, Frauen weibliche Vorbilder suchen; und es ist auffallend, dass Juden Figuren aus dem AT, Christen aus dem NT wählen. Auffällig werden die Erkrankten durch öffentliche Predigten oder Gebete, manchmal auch durch weite Gewänder oder Bettlaken, die demonstrativ als Kleidung verwendet werden. Die Bezeichnung stammt von dem israelischen Arzt Yair Bar El (Bar-El […] 2000), der Anfang der 1980er als erstes das Krankheitsbild diagnostizierte und seitdem über 400 Betroffene in der psychiatrischen Klinik „Kfar Shaul“ behandelte. Auch er beobachtete eine oft klar erkennbare Disposition für den Übertritt in die psychotische Episode, sei es auf Grund psychischer Labilität, sei aus auf dem Hintergrund exzessiver Religiosität. Kalian/Witztum (1999) gehen sogar so weit, den Eintritt in die projektiv-psychotische Identität als eigentlichen Grund uns als Ziel der Jerusalem-Reise anzusehen, eine Orientierung, die sie bis ins 19. Jahrhundert zurückverfolgen.
Alexander van der Haven (2008) geht noch einen Schritt weiter, wenn er annimmt, dass das Syndrom sich erst im öffentlichen Auftritt vollende, weil die Aktion einer heiligen Figur, mit der die Identifikation in einem magischen Übertragungsvorgang gelungen ist, Teil einer subkulturellen religiösen Praxis ist. Folgt man van der Havens Argumentation, schließt sich der Kreis wieder an die Überlegungen über das Stendhal-Syndrom an. Es ist nicht eine wie auch immer beschaffene ursprüngliche Kraft, die vom Kunstwerk ausgeht und den Betrachter zum Erlebnis des Selbstverlustes treibt (wie man in der Rede etwa vom „Rubens-Syndrom“ meinen könnte)[6], sondern vielmehr eine selbstorganisierte Erlebnis-Episode des Syndromierten. Im Falle des Jerusalem-Syndroms ist es die Performance des Syndroms, eine theatrale Aktion, die des Publikums bedarf.
Dagegen ist das Stendhal-Syndrom vor allem an den Syndromierten selbst adressiert, in einer narzisstischen Spiegelung, in der das auslösende Kunstwerk als Objekt funktionalisiert ist. Vor allem letzterer Vorgang ist nicht aufzulösen, wenn nicht ein Horizont erworbenen Wissens, eine individuelle Bildungsgeschichte, eine soziale Achtung von Kunstsensibilität, vielleicht sogar eine Subkultur der „Kunstreligion“, in der die Spiritualität des Kunsterlebnisses als formative Qualität behauptet ist, mitgedacht wird. Vielleicht gehört zum Stendhal-Syndrom die Syndrom-Erzählung dazu, mit der sich der Befallene Zeitgenossen gegenüber darstellen kann, so, wie der Auftritt als Identifizierender zum Jerusalem-Syndrom gehört.
Noch eine zweite Schlussfolgerung liegt angesichts der Berichte über das Stendhal-Syndrom im engeren Sinne nahe: Es sind Werke der Malerei und der Bildhauerei, angesichts derer sich der syndromatische Effekt einstellt (oft unterstützt durch den musealen Ort[7]). Alle Zeitkünste – von der Musik über das Theater bis zum Film – spielen im Feld möglicher Auslöser des Syndroms ebenso wenig eine Rolle wie die geschriebene Literatur.[8] Es scheint, als ob die Statik des Objekts der Anschauung eine Bedingung dafür wäre, Zeit dafür zu geben, dass der Betrachter sich in einen Modus des ästhetischen Zuwendung hineinfinden kann, der erst danach als psychische und somatische Störung greifbar wird.[9]
Anmerkungen
[1] Zit. aus Stendhal 1964, 234; vgl. dazu Bogousslavsky/Assal 2010.
[2] Ein zweites, im Kontext des Stendhal-Syndroms öfters genanntes, allerdings irreführendes Beispiel ist Marcel Proust, der ständige Anfälle von Blähungen und anderen Verdauungsproblemen sowie Asthma hatte, als er seinen Roman A la recherche du temps perdu schrieb; im Kontext des Romans tritt allerdings eine Figur auf, die mit Indikatoren des Stendhal-Syndroms auf eine Besichtigung von Vermeers „Ansicht von Delft“ reagiert (Teive […] 2014).
Vor allem an autobiographischen Schriften sucht Clausen zu zeigen, wie Annahmen über das Wesen von Kunst und erlebte Kunstrezeption, aber auch praktiziertes Kunstschaffen Hand in Hand gingen; vgl. Clausen 2006; vgl. v.a. Kap. 4 zur Untersuchung einzelner Texte und ihrer autobiographischen Bezüge.
[3] In welchem Umfang man Fan-Begeisterungen der beschriebenen Art mit Konzepten der Hysterie, wie sie der Pariser Arzt Jean-Martin Charcot Pariser Klinik Salpêtrière im späten 19. Jahrhundert studierte und in zahlreichen Photographien dokumentierte, zusammenbringen kann, will ich hier nicht diskutieren; allerdings nötigte er seine Probanden dazu, Posen einzunehmen, wie sie als Muster von der christlichen Ikonographie geprägt worden waren, sich also direkt an kulturelle Bildgeschichte anlehnten; vgl. dazu immer noch Didi-Huberman, Georges: Erfindung der Hysterie. Die photographische Klinik von Jean-Martin Charcot. München: Fink 1997.
Auch auf die Frage, welche Rolle zeitgenössische Konzepte der Ekstase in den Theorien der Kunstrezeption der Zeit spielten, werde ich hier nicht weiter eingehen; vgl. dazu aber Schimpf, Simone: Heilig oder verrückt. Die Visualisierung von Ekstase in Kunst und Medizin im Frankreich des 19. Jahrhunderts. In: Sichtbarkeit und Medium. Austausch, Verknüpfung und Differenz naturwissenschaftlicher und ästhetischer Bildstrategien. Hrsg. v. Anja Zimmermann. Hamburg: Hamburg University Press 2005, S. 47-71, sowie Schmidt, Renate-Berenike/Schetsche, Michael: Zwischen medialer Inszenierung und subjektivem Erleben. Ekstase aus sozialwissenschaftlicher Perspektive. In: Bewußtseinswissenschaften 25,2, 2019, S. 91-101.
[4] Magherini 1989; der Untersuchung vorangegangen war ein Bericht über die eigenartigen Beobachtungen in Florenz (Magherini 1977). Fast 20 Jahre später kam die Autorin nochmals unter dem Titel „Ich habe mich in eine Statue verliebt“ auf das Thema zurück (2007).
[5] Vgl. Rivet […] 1993; Quilichini […] 2005.
[6] Als Rubens-Syndrom bezeichnet man gelegentlich einen Anstieg sexueller Erregung[potentiale] bei der Besichtigung von Rubens-Bildern – in scharfem Kontrast zu den negativen, das Ich belastenden Effekten des Stendhal-Syndroms; vgl. Griffiths 2014, der interessanterweise den aktiven Teil der Rezeption als „Angriff der Kunst“ (art attack) auf das Werk verlagert.
[7] Ob auch Architektur zu den syndromaffinen Objekten der Kunstanschauung rechnet, ist unklar; immerhin wird in der Literatur manchmal auf Sigmund Freud hingewiesen, der beim Anblick der Akropolis in Athen eine Erinnerungsstörung erlebte (vermutlich 1903; berichtet in einem Brief an Romain Rolland; veröffentlicht in: Almanach der Psychoanalyse 12, 1937, S. 9-21).
[8] Es sei aber darauf hingewiesen, dass es mehrere Versuche gibt, das Stendhal-Syndrom zu dramatisieren. Die beiden einzigen filmischen Beispiele sind der Giallo-Thriller La sindrome di Stendhal (Italien 1996, Dario Argento), in dem die ermittelnde Kommissarin selbst zum Opfer des Syndroms wird und fast ermordet worden wäre, und der Tatort-Krimi Im Schmerz geboren (BRD 2014, Florian Schwarz), in dem der Bösewicht der Gefahr ausgesetzt ist, zum Opfer des Syndroms zu werden.
[9] Ob Filme, die zwar physikalisch in Zeit ablaufen, aber auf eine semantische Indikation der Zeitlichkeit des Dargestellten verzichten – wie manche Filme des experimentellen und psychedelischen Kinos – Raum für ähnlich komplexe individuelle Rezeptionseffekte haben, die dem Stendhal-Syndrom vergleichbar wären, ist anhand der vorliegenden Literatur nicht nachweisbar. Auch die Frage, ob es einen Zusammenhang mit dem Rhythmus der Erzählung, dem Einsatz extrem langer Einstellungen (etwa in den Filmen Béla Tarrs) etwa, und den Strategien von Zuschauern, die auf die Erreichung der Symptome des Stendhal-Syndrom ausgerichtet sind, gibt, ist zumindest ad hoc nicht zu klären.
Literatur
Airault, Régis: Voyages et risques de décompensations psychiatriques. In: La Revue du Praticien 65,4, 1.4.2015, S. 509-512.
Amâncio: Edson José: Dostoevsky and Stendhal’s Syndrome. In: Arquivos de Neuro-Psiquiatria 63,4, 2005, S. 1099–1103.
American Psychological Association (ed.): Diagnostic and statistical manual of mental disorders (DSM-IV). Publ. by the American Psychiatric Association. 4. ed. Washington, D.C.: American Psychiatric Association 1994, XXVII, 886 S.
Bamforth, Iain: Stendhal’s Syndrome. In: British Journal of General Practice 60,581, 2010, S. 945-946.
Bar-el, Yair […]: Jerusalem syndrome. In: British Journal of Psychiatry 176, 2000, S. 86-90.
Bogousslavsky, Julien / Assal, Gil: Stendhal’s aphasic spells. The first report of transient ischemic attacks followed by stroke. In: Neurological Disorders in Famous Artists. 3. Ed by Julien Bogousslavsky, M.G. Hennerici, H. Bäzner & C. Bassetti. Basel […]: Karger 2010, S. 130-143 (Frontiers of Nurology and Neuroscience. 27.).
Clausen, Jens [Jürgen]: Das Selbst und die Fremde. Über psychische Grenzerfahrungen auf Reisen. 2. Aufl. Bonn: Psychiatrie-Verlag 2008, 340 S. (Edition das Narrenschiff.). [Zuerst u.d.T..: Vom Verlust des Selbst in der Fremde. Eine Studie über das Reisen– anhand autobiographischer Texte. Diss., Münster, Westfälische-Wilhelms-Universität 2006, 277 S.]
Datta, Swarna: Stendhal Syndrome: A Psychological Response Among Tourists. In: Psychology and Cognitive Sciences: Open Journal 3,2, 2017, S. 66-73.
de Oliveira, Ianick Takaes: Touch of Venus. Notes on a Cardiac Arrest at the Uffizi. In: Figura 8,1, 2020, S. 115-149.
Didi-Huberman, Georges: Erfindung der Hysterie. Die photographische Klinik von Jean-Martin Charcot. München: Fink 1997.
Drost, Wolfgang: Erotics of art – ein Syndrom? Zum Hedonismus in Stendhals Kunstkritik. In: Blickränder: Grenzen, Schwellen und ästhetische Randphänomene in den Künsten. Hrsg. v. Astrid Lang & Wiebke Windorf. Berlin: Lukas Verlag für Kunst- und Geistesgeschichte 2017, S. 34-42.
Freedberg, David/Gallese, Vittorio: Motion, Emotion and Empathy in Aesthetic Experience. In: Trends in Cognitive Sciences 11,5, May 2007, S. 197-203.
Goleman, Daniel: Analyzing the New York Syndrome. In: The New York Times, 4.11.1984, Sect. 6, S. 139.
Griffiths, Mark D.: Having an Art Attack. A Brief Look at Stendhal Syndrome. In: Psychology Today, 10.3.2014.
Kalian, Moshe/Witztum, Eliezer: „The Jerusalem syndrome“. Fantasy and reality a survey of accounts from the 19th century to the end of the second millennium. In: Israel Journal of Psychiatry and Related Sciences 36,4, 1999, S. 260–271.
Magherini, Graziella: Salute mentale e territorio. Rapporto dal servizio di igiene mentale del centro di Firenze. Roma/Firenze: Centro italiano studi e indagini per la programmazione sanitaria e sociale / Le Monnier 1977, VII, 89 S. (Collana CISI di studi medico-sociali e di programmazione socio-sanitaria, 4.).
Magherini, Graziella: La síndrome di Stendhal. Firenze: Ponte alle Grazie 1989, 182 S.
Repr.: Firenze: Ponte alle Grazie, 2003, 219 S.
Frz.: Le syndrome de Stendhal. Du voyage dans les villes d’art. Trad. de l’italien par Françoise Liffran. Paris: Usher 1990, 210 S. (Esthétique – Voyage – Psychologie – Art – Émotions.).
Span: El síndrome de Stendhal. Madrid: Espasa Calpe D.L. 1990, 223 S. (Espasa mañana., Ensayo.).
Magherini, Graziella: Mi sono innamorato di una statua. Oltre la Sindrome di Stendhal. Florenz: Nicomp 2007, 336 S.
Nicholson, Timothy Richard Joseph / Pariante, Carmine / McLoughlin, Declan: Stendhal Syndrome: A Case of Cultural Overload. In: BMJ Case Reports, 20.2.2009, URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3027955/.
Quilichini, Stéphane / Rivet, Bruno / Paulin, Pierre: Syndromes et maladies psychiatriques à nom propre In: Perspectives Psy 44, Oct.-Nov. 2005, S. 311-323.
Rivet, Bruno […]: Les syndromes à noms propres en psychiatrie. In: Psychologie médicale 25,12, 1993, S. 1207-1211.
Sanchez, L.P. […]: Stendhal Syndrome. A clinical and historical overview. In: Arquivos de Neuro-Psiquiatria 76,2, 2018, S. 120-123.
Schimpf, Simone: Heilig oder verrückt. Die Visualisierung von Ekstase in Kunst und Medizin im Frankreich des 19. Jahrhunderts. In: Sichtbarkeit und Medium. Austausch, Verkn üpfung und Differenz naturwissenschaftlicher und ästhetischer Bildstrategien. Hrsg. v. Anja Zimmermann. Hamburg: Hamburg University Press 2005, S. 47-71.
Schmidt, Renate-Berenike/Schetsche, Michael: Zwischen medialer Inszenierung und subjektivem Erleben. Ekstase aus sozialwissenschaftlicher Perspektive. In: Bewußtseinswissenschaften 25,2, 2019, S. 91-101.
Stainer, D./Ramacciotti, F. / Colombo, G.: Death in Venice. Does a laguna syndrome exist? In: Minerva Psichiatrica 42, 2001, S. 125-140.
Stendhal [d.i. Marie-Henri Beyle]: Reise In Italien. In: Stendhal: Gesammelte Werke. Hrsg. v. Manfred Naumann. Berlin: Rütten und Löning 1964.
Teive, Hélio A.G. / Munhoz, Renato P. / Cardoso, Francisco: Proust, Neurology and Stendhal’s Syndrome. In: European Neurology 71,5-6, 2014, S. 296-298.
Viala, A. […]: Les Japonais en voyage pathologique à Paris. Un modèle original de prise en charge transculturelle. In: Nervure: Journal de Psychiatrie 5, 2004, S. 31-34.
van der Haven, Alexander: The Holy Fool Still Speaks. The Jerusalem Syndrome as a Religious Subculture. In: Jerusalem: Idea and Reality. Ed. by Tamar Mayer & Suleiman A. Mourad. London/New York: Routledge 2008: 103–122.
Yayak, Asli: Stendhal (Florence) Syndrome as an Unclassified Disorder. In: Studies on Ethno-Medicine 13,4, Sept. 2019, S. 190-197.