Konfektionierte Affekte
Der Kulturwissenschaftler und Journalist Andreas Bernard fügte der bereits langen Liste mit Veränderungen, die durch Instagram bewirkt worden sein sollen, kürzlich noch einen Punkt hinzu. Instagram, so seine These, „war die beste Schule für die coronabedingte Affektkontrolle“. Ohne Vorbereitung durch „Social-Media-Kompetenz“ hätten viele Menschen es nicht so gut und schnell hinbekommen, die Herausforderungen des ‚social distancing’ durchzustehen. Die „Unterdrückung elementarer Affekte der Rührung, Empathie oder Begeisterung“ sei vielmehr nur gelungen, weil es bereits eine „Gewandtheit“ gebe, „mit der die Menschen heute ihre Affekte modellieren“.[1]
Ich glaube nicht, dass Bernards These stimmt. Zumindest ist sie zu unscharf formuliert. Denn Affekte zu unterdrücken und etwa auf eine Umarmung zu verzichten, ist etwas anderes, als Affekte zu modellieren, also bewusst mit ihnen und ihrem Ausdruck umzugehen. Wer sie kontrollieren kann, kann sie auch unterdrücken, lässt sich zwar behaupten, doch wer sie im Griff hat, braucht sie gar nicht mehr zu unterdrücken, kann man darauf antworten. Für eine Umarmung lässt sich dann ein Äquivalent finden, das seinerseits ebenfalls Zuneigung zum Ausdruck bringt.
Dennoch ist Bernards These interessant, da sie zumindest implizit einem häufig geäußerten Vorbehalt gegenüber Instagram und den Social Media widerspricht. Wird es nämlich oft als Verlust an Authentizität kritisiert, dass und wie viele sich und ihr Leben für ihre Accounts in Szene setzen, und wird daran meist eine allgemeine Medienschelte angeschlossen, so ist der medial eingeübte, reflektiert-kontrollierte Umgang mit Affekten für Bernard ein Fortschritt. Ausdrücklich beruft er sich auf Norbert Elias und den ‚Prozess der Zivilisation’, sieht die in der Pandemie notwendigen und sich bewährenden Praktiken also als weiteren Schritt auf dem langen Weg zu immer mehr „Verhaltensregulierung“ und damit zu immer noch kultivierteren Formen menschlichen Zusammenlebens.
Als Beispiel für seine These erwähnt Bernard den Fußballspieler Mario Balotelli, der vor einigen Monaten nach einem erfolgreichen Torschuss nicht etwa gleich jubelte, sondern aus dem Spielfeld lief, sich ein Smartphone reichen ließ und dann erst seine Mitspieler um sich versammelte, um mit ihnen zusammen einen Freudentanz für die Follower auf Instagram aufzunehmen.
https://www.instagram.com/p/B_F6rpBq5zj/
Auch dieses Beispiel bestätigt jedoch meinen Einwand, wonach es bei Inszenierungen für die Social Media keineswegs um Affektunterdrückung geht. Vielmehr nimmt Balotelli sich sogar eigens Zeit, einen Affekt zu choreografieren und dann um so expressiver aufzuführen. Manche würden zwar kritisieren, dass die Freude der Fußballspieler am Spielfeldrand nur noch nachgestellt ist und der ‚eigentliche’ Moment zugunsten der medialen Inszenierung verpasst wurde. Doch genauso kann man es als Leistung würdigen, dass die Spieler ihre Gefühle kurz zurückhalten und erst dann zum Ausdruck bringen, wenn sichergestellt ist, dass auch die Follower online daran teilhaben können, wenn daraus also ein umso größeres, umso stärker verbindendes Ereignis werden kann. Im Fall von Balotellis Instagram-Account geht es um immerhin rund neun Millionen Follower.
Passender wäre es also, hier von einer Verlagerung des Affektausdrucks zu sprechen. Und wer wollte ausschließen, dass der Affekt nicht sogar noch intensiver empfunden wird, wenn er, statt nur spontan geäußert zu werden, bewusst zu einem (bewegten) Bild ausgeformt wird? Wird er nicht umso realer, so könnte man die Medienkritiker fragen, je gezielter er gestaltet und zelebriert ist, je mehr er dadurch sogar einen Werkcharakter annimmt?
Gerade Mario Balotelli hat sich auch früher schon als Virtuose der Affektinszenierung erwiesen und ist sogar Schöpfer einer der einprägsamsten Gesten der letzten Jahre. Nachdem er für die italienische Nationalmannschaft im Halbfinale der Fußball-EM 2012 gegen Deutschland das zweite Tor geschossen hatte, jubelte er nämlich nicht etwa, sondern streifte sein Trikot ab, präsentierte seinen muskulösen Oberkörper und hielt die Arme leicht angewinkelt nach unten. Manche erkannten in der Pose auch eine politische Aussage. Oder sehen die Arme nicht wie im Kampf gegen Fesseln aus? Protestierte Balotelli damit also nicht gegen die Unterdrückung der Schwarzen? Als die starke Geste im Nu zum Internet-Meme avancierte, fand der Rassismus allerdings eine demütigend-bösartige Fortsetzung: Balotelli wurde als Ballerina oder brunftiger Macho sexualisiert oder zum primitiven Stammeshäuptling degradiert.
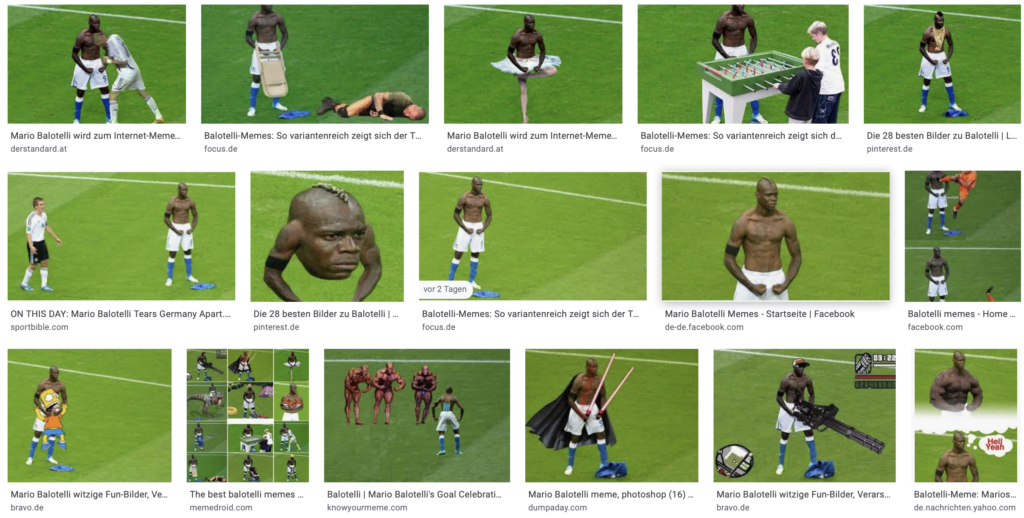
Da Memes ihren Ausgang aber oft von einer starken Geste nehmen, ist erst recht offensichtlich, dass die Social Media keine Schule der Affektunterdrückung oder der Affektkontrolle, dafür aber eine Schule der Affektgestaltung sind. Gerade der Erfolg von Memes verführt dazu, mit besonders markanten, originellen, zugespitzten Gesten Aufmerksamkeit zu suchen, und in einer Welt, in der die Social Media immer wichtiger werden, lässt es sich sogar als eigene Begabung ansehen, wenn jemand Gefühle und Stimmungen anschaulich-stark auszudrücken vermag. Andere Praktiken der Social Media wie etwa Selfies führen hingegen dazu, dass man lernt, einen Affekt auf idealtypische Weise – richtig platziert und richtig dosiert, vor allem möglichst präzise – zum Ausdruck zu bringen. Mimik und Gestik werden in den Social Media also insgesamt sehr bewusst eingesetzt.
Damit aber geschieht auf vielen Bildern der Social Media heute etwas Ähnliches wie bereits in manchen Epochen und Gattungen der Kunstgeschichte. Man denke etwa an Gemälde der französischen Genremalerei des 18. Jahrhunderts, die in den Pariser Salon-Ausstellungen ihren großen Auftritt hatten. Denis Diderot, der mehrere dieser Ausstellungen umfangreich rezensierte, widmet sich in seiner Besprechung des Salons von 1763 etwa ausführlich einem Bild von Jean-Baptiste Greuze, das für ihn beispielhaft zeigt, was es heißt, Affekte jeweils angemessen darzustellen. Zu sehen ist eine Familie, gruppiert um einen alten Mann, den Großvater, der mal als gelähmt, mal sogar als sterbend beschrieben wird.

Jean-Baptiste Greuze: The Paralytic, 1763
Diderot würdigt, Greuze habe bei jedem Protagonisten „genau den Grad an Anteilnahme [gezeigt], der seinem Alter und seinem Charakter entspricht“.[2] Die Kinder und jungen Erwachsenen blicken schüchtern und besorgt, da sie begriffen haben, dass es um den Großvater nicht zum besten steht, die Bedeutung des Geschehens aber noch nicht ganz ermessen können. Dagegen wirkt ein Mann in der Mitte ernst, ist ihm doch bewusst, dass er in der Nachfolge des Alten bald die Rolle des Familienvorstands zu übernehmen hat. Eine ältere Frau erscheint bereits etwas abgestumpft und schwerhörig, bekundet aber immerhin noch Anteilnahme. Alle sind mit ihrem Tun auf den Alten hin ausgerichtet und tragen auf jeweils unterschiedliche Weise dazu bei, dass sie gemeinsam als Familie eine schwierige Situation würdevoll meistern.
Ein solches Genrebild entstand nicht ohne pädagogische Absicht. Indem Greuze die Szene so differenziert und feinfühlig darstellte, sollten die Betrachter ihrerseits zu mehr Sensibilität erzogen werden. Diderot lobte das Familiengemälde auch deshalb, weil er beobachten konnte, dass es bei den Salon-Besuchern starke Gefühle zu wecken vermochte, ja sie ähnlich wie ein Theaterstück ergriff und damit dazu brachte, selbst an der Situation Anteil zu nehmen, sich in die dargestellten Figuren hineinzuversetzen und auf diese Weise deren mustergültige Affekte einzuüben. Für Diderot erfüllten sich damit alle Erwartungen gegenüber Kunst, und er würdigte, dass der Maler „endlich mit der dramatischen Dichtung wetteifert, um uns zu ergreifen [toucher], zu belehren [instruire], zu bessern und zur Tugend anzuhalten“.
Gestaltete hier der Maler die Figuren seiner Bilder so überzeugend, dass bestimmte Affekte sichtbar wurden, so passierte dasselbe in der von Diderot angesprochenen dramatischen Dichtung, also im Theater vor allem durch die Leistung der Schauspieler. Ihre Mimik und Gestik, ihre Art des Sprechens fungierte als Vorbild für die Zuschauer. Das Theater war lange die wohl wichtigste Schule der Affektgestaltung, Film und Fernsehen lösten es ab. Und heute sind es die Social Media, in denen gerade auch Affekte in Szene gesetzt und mit Followern geteilt werden. Der große Unterschied zu früher ist jedoch, dass die meisten derer, die sich und ihre Affekte verbildlichen, keine ausgebildeten Schauspieler sind. Und viele sind auch nicht so begabt und mutig wie Mario Balotelli.
Immer wieder stößt man aber auf Bilder oder Bildfolgen, in denen selbst belastende und extreme Affekte auf eine Weise dargestellt sind, die einen Vergleich mit Genrebildern à la Greuze gerechtfertigt erscheinen lässt. Manche setzen sogar etwas so Heftiges wie Trauer – den Schmerz über den Verlust naher Angehöriger – in Szene. Zwar handelt es sich dabei um kein auf einen Moment zugespitztes Gefühl, es ist also anders als bei Balotellis Jubel keine Ausdrucksverzögerung zu vollbringen, aber Trauer ist mindestens so vereinnahmend wie die Freude, die ein Tor auslöst, weshalb es eigentlich kaum möglich erscheint, sie zusätzlich dazu, dass sie einem widerfährt, noch eigens zu inszenieren. Außerdem gehört Trauer – anders als ein Torjubel – zu den Empfindungen, bei denen man auf sich selbst zurückgeworfen wird, was das Interesse mindert, sie öffentlich, für alle sichtbar auszuleben. Trauer hat privaten Charakter und eignet sich nicht zur Inszenierung. Woher sollte man die dafür nötige Energie sowie die nötige Distanz aufbringen? Höchstens ein Maler à la Greuze, so würde man mutmaßen, kann es übernehmen, ihren Ausdruck als Beobachter von außen festzuhalten und ins Bild zu setzen. Was aber bedeutet es und wie sieht es überhaupt aus, wenn die Betroffenen selbst ihre Trauer gestalten?
Auf einem Instagram-Account zeigt etwa eine in Köln ansässige Familie detailgenau, wie sie die Diagnose einer unheilbaren Krankheit ihres Babys empfängt, wie sie die letzten Tage mit ihm verbringt, seinen Tod und die Zeit danach erlebt. Begleitende Texte erklären die Bilder ausführlich, von denen jedes einen markanten Moment der Leidens- und Trauergeschichte festhält. Auf einem Foto sieht man die Eltern, die sich über den Korb beugen, in dem das Baby lag und der nun mit Spielsachen gefüllt ist, die als Grabbeigaben fungieren sollen. Mutter und Vater halten jeweils ein Stofftier in einer Hand, mit der anderen Hand fasst die Frau den Mann leicht am Oberarm, was von der Verbundenheit der Trauernden, aber auch von der Intimität ihres Trauerns zeugt. Neben dem Körbchen steht eine angezündete Kerze. Jede Geste, jedes Bildsujet wirkt hier so sorgfältig komponiert und gestaltet wie auf einem Genrebild von Greuze.
Auf anderen Fotos, oft Selfies, sieht man das Gesicht der Mutter ganz nah: erschöpft und ungeschminkt. Oder sie weint und hält das tote Kind in den Armen. Auch sonst sind auf dem Account immer wieder Fotos des toten Babys zu sehen, und einmal ist es sogar auf dem Schoß des zweieinhalbjährigen Bruders platziert. In jedem Fall wird der Leichnam unmittelbar, ohne vorausgehende Triggerwarnung präsentiert. Diese Direktheit ist ungewöhnlich, und die offene Einbeziehung des Kleinkinds, das über seine Rolle nicht frei entscheiden kann, verletzt mutmaßlich sogar Persönlichkeitsrechte. (Deshalb würde ich derartige Bilder auch nie an anderen Orten zeigen; jenseits des Accounts, auf dem sie gepostet wurden, sollten sie nicht sichtbar sein.)
Spätestens jetzt wird bewusst, dass im Unterschied zu Greuze, der sich seine Gemälde ausgedacht hat, auf den Fotos reale Menschen zu sehen sind. Und die Eltern haben es nicht nur zugelassen, sondern sogar viel dafür getan, dass ihre Gefühle in einer Extremsituation festgehalten und öffentlich sichtbar gemacht wurden. Sie haben die Entscheidung getroffen, es etwa auch dann zu fotografieren, wenn sie den Korb mit dem toten Baby aus dem Krankenhaus tragen. Zwar mag das Bild hier eine dritte Person gemacht haben, und für einige Aufnahmen haben die beiden sogar professionelle Fotografen engagiert, doch ändert das nichts daran, dass sie sich selbst in ihrer Trauer zeigen und dass sie diese für ihre Follower eigens inszenieren. Dabei wird selbst noch auf die Einhaltung eines einheitlichen Farbkonzepts geachtet, und auch sonst stellen die Trauer-Bilder in ihrer Machart und Ästhetik keine Ausnahme innerhalb des Accounts dar. Selbst ein emotionaler Ausnahmezustand ist also noch in eine Gesamtinszenierung eingebunden, ist Teil einer mal beschaulicheren, mal dramatischeren Lebensgeschichte.
Tatsächlich nutzt die Mutter den Account bereits seit mehreren Jahren, um sich eine kleine Karriere als Influencerin aufzubauen. Professionalität und Routine beim Erstellen ansehnlicher Bilder, beim Sich-Adressieren an Follower sind für sie somit offenbar so selbstverständlich, dass sie damit einfach fortfuhr, als der Schicksalsschlag sie und ihre Familie traf. Noch direkt davor hatte sie für Schwangerschaftsprodukte und Babysachen geworben, und ein paar Wochen nach dem Tod des Babys postete sie bereits wieder Bilder, auf denen Konsumprodukte im Zentrum stehen, wollte sie ihren mittlerweile mehr als 70000 Followern doch etwa mitteilen, wie sie die Wohnung in der Trauerphase umdekoriert hat.
In Rückbezug auf Greuze und Genrebilder des 18. Jahrhunderts könnte man bei Accounts wie diesem auch davon sprechen, dass nicht nur Konsumverhalten vorgeführt und Lebensstile in Szene gesetzt werden, sondern dass erst recht der Umgang mit bestimmten – und gerade auch existenziellen – Situationen demonstriert wird. Die Eltern werden zu Affektgestaltungs-Influencern; sie erzeugen Empathie bei all denen, die dem Account folgen und sich angesichts dessen, was ihnen gezeigt wird, emotional in die Lage der Betroffenen hineinversetzen. So aber üben sie die entsprechenden Affekte und Verhaltensweisen auch ein.
Die Social Media als Schule der Affektgestaltung zu bezeichnen, ist aber erst deshalb berechtigt, weil ein solcher Account kein Einzelfall ist. Vielmehr ist die fotografische Inszenierung ihres Lebens gerade bei Influencern mittlerweile oft so stark in Fleisch und Blut übergegangen, dass sie gar nicht auf die Idee kämen, davon jemals abzusehen. So gerne man gerade Instagram vorhält, zu geschönte Leben zu zeigen, so sehr muss man doch zugeben, dass Schicksalsschläge keineswegs tabuisiert werden. Da sie jedoch genauso professionell wie andere Ereignisse fotografisch aufbereitet werden, erscheinen sie in überhöhter Form: idealtypisch performt, vorbildlich ästhetisiert – und damit doch auch wieder geschönt wie ein altes Genrebild.
Das kann noch weiter gehen als bei dem Kölner Account. Eine Influencerin aus Kalifornien, die üblicherweise für ätherische Öle, aber auch für Kinder- und Haushaltszubehör wirbt und mehr als eine halbe Million Follower hat, integrierte das Sterben ihrer knapp dreijährigen Tochter, bei der ein aggressiver Gehirntumor diagnostiziert worden war, nahezu nahtlos in ihr Bildprogramm. Nur einmal, direkt nach der Diagnose, zeigt sie sich in einer Reihe von Selfies in grenzenlosem Schmerz. Die Heftigkeit des Affekts wird hier ganz traditionell allein durch die Mimik beglaubigt. Doch sonst wird viel getan, um die Ausnahmesituation zu ästhetisieren. Damit die todkranke Tochter nochmal einen Geburtstag erleben kann, wird er vorgefeiert und besonders groß inszeniert. Da Influencer kaum etwas so gut können wie konsumieren, arrangieren, dekorieren, ziehen sie sich darauf also auch in einer Krisensituation zurück. Die ‚déformation professionelle’ reicht in diesem Fall sogar so weit, dass die einzelnen Geschenke und Deko-Artikel auf den Fotos genauso mit Links zu den Herstellern und Marken versehen werden wie bei jedem anderen Influencer-Bild auch. Und selbst bei Fotos, die die todkranke Tochter zeigen, verzichtet die Mutter nicht darauf, Werbung zu machen – als sei es wichtig, wer die Decke produziert hat, unter der das Mädchen seine letzten Tage verbracht hat.

Im Gegenzug zu so viel emotionaler Werbung startete der Hersteller der Decken eine Kampagne, die darin bestand, einen Monat lang einen Teil der mit ihrem Verkauf erzielten Umsätze an die betroffene Familie zu spenden. Anteilnahme an deren Schicksal, ja Mitgefühl konnte so durch einen Konsumakt artikuliert werden. Aber damit nicht genug. Nach dem Tod des Mädchens ließen die Eltern mehrere Kleidungsstücke im Andenken an ihre Tochter herstellen, die die Follower kaufen konnten, um auch nach außen hin ihre Verbundenheit zu demonstrieren. Für die Hoodies und Shirts machte die Mutter wiederum Werbung, indem sie sich auf ihrem Account damit bekleidet zeigte. Damit wurde sie zur Influencerin hinsichtlich ihrer eigenen Trauerarbeit, lebte sie mit diesen Bildern ihren Followern doch auch vor, wie sich der Tod eines Kindes im Lifestyle angemessen ausdrücken lässt.
Wer einen so starken Affekt wie Trauer durch Produkte gestaltet, bindet sie aber nicht nur besser in das alltägliche Leben mit seinen vielen anderen Konsumereignissen ein. Durch die Serienproduktion werden die Affekte vielmehr auch gut verpackt portioniert, an die diversen Käufer verteilt und damit wohl besser erträglich gemacht. Wer eines der Kleidungsstücke kauft, nimmt den Eltern symbolisch einen kleinen Teil der Last ab. Und auch das Mitleid bekommt so eine Form und ist besser zu bewältigen. Es wundert also nicht, dass die Kleidungsstücke im Nu ausverkauft waren und Follower sogar um noch mehr Produkte baten.
In der konsumistischen Logik der Social Media und des Influencertums kann Affektgestaltung somit sogar zur Affektbewältigung führen. Sie bleibt nicht auf die Körper der Protagonisten beschränkt, sondern wird Teil der Dingkultur, wird konfektioniert und kommodifiziert. Das geht weit über das hinaus, was von Genrebildern des 18. Jahrhunderts geleistet werden konnte. Und hier wird sicher nichts unterdrückt, wie es Andreas Bernard behauptet hat, Affekte werden aber auch nicht nur kontrolliert und modelliert wie bei Balotelli. Vielmehr sieht es so aus, als könne ein Soziales Medium wie Instagram sogar den Charakter von Affekten verändern. Gerade die bisher intimsten Affekte erfahren eine Entprivatisierung. Sie werden für Follower erlebt und aufbereitet, mit ihnen geteilt und damit auch gemeinschaftlich verarbeitet.
Anmerkungen
[1] Andreas Bernard: “Zivilisation im Zeitraffer”, in: Die ZEIT 25/2020, auf: https://www.zeit.de/2020/25/corona-pandemie-verhalten-zivilisation-fussball.
[2] Denis Diderot: Salons, Vol. 3 (hg. v. J. Seznec/ J. Adhémar), Oxford 1967, S. 231ff. (dt. „Salon 1763“, in: ders.: Ästhetische Schriften, Bd. 1 (hg. v. F. Bassenge), Berlin 1984, S. 462-465).
Diesen Beitrag gibt es auch als Videoessay auf dem YouTube-Channel von Digitale Bildkulturen.
Wolfgang Ullrich ist freier Autor.


Pingback: Konfektionierte Affekte. Trauerarbeit auf Instagram