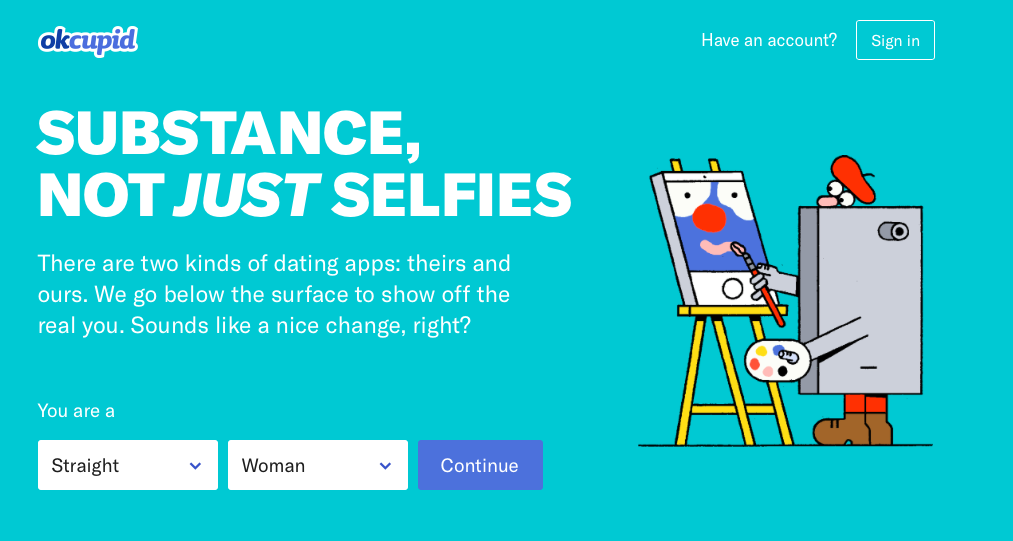Kuratierte Beziehungen
„You’re a total catch!“, sagt mir das Onlinedating-Portal OkCupid und fordert mich auf, zur ‚Rush Hour’ ein bisschen mehr Aktivität zu zeigen. Ich verteile also einige ‚Likes’ per Sternchen und lade schnell noch ein weiteres Foto von mir hoch. Ohne Sichtbarkeit keine Chance, so lerne ich hier. Beim nächsten ‚Like’-Klick werde ich überrascht: Jemand hat auch mir ein Sternchen gegeben. Automatisch öffnet sich ein Chatfenster zwischen mir und dem auserkorenen Profil, mein Adrenalinspiegel steigt. Nichts passiert, ich klicke weiter. Gibt es noch bessere Optionen zur Auswahl?
Vielleicht fing die Debatte über ‚Liebe 2.0’ dort an, wo zunächst keine digitalen Profile zu ‚matches’ verquickt wurden; sondern zu jenem Zeitpunkt, als der Begriff der ‚quality time’ in mediale Diskurse und Coaching-Programme Einzug hielt und die Ansprüche an die eigene Freizeit deutlich anstiegen. Es wirkt paradox, dass im gleichen Zuge das durch die gemeinsame Zeit entstehende Liebesleben mit dem Schlagwort der Beziehungsarbeit versehen wird. Die quality time einer Beziehung wäre damit das Resultat erfolgreich erledigter Arbeit. Daran ist nicht nur abzulesen, dass dem Phänomen widersprüchliche Kommunikationsformen zugrunde liegen, sondern es zeigt sich auch als eine Konsequenz neoliberaler Ökonomien, die im Sinne gouvernementaler Lebensführung weit in den Alltag liebender Subjekte vorgedrungen ist.[1]
Überschattet vom Druck, nicht nur viel Zeit in die Arbeit zu investieren, sondern zudem viel Arbeit in das private Zeitbudget zu stecken, kann eine Mischung aus Anspruchsdenken und endlosem Spiel der Möglichkeiten schnell zu toxischen Verstimmungen führen; Überforderung, Panik, Minderwertigkeitsgefühle – wo kann da noch die zarte Pflanze der Liebe gedeihen? Wenn Erreichbarkeit zum legitimen Grundbedürfnis einer Gesellschaft erwachsen kann und Mobilität zum Muss der privilegierten Klasse gehört, werden damit nicht nur Kontaktmöglichkeiten potenziert. Im wachsenden Gewirr der Anschlüsse geht der Augenblick des Kontakts zunehmend mit Distanz einher: Kontakt findet in verschiedenen Zeitzonen statt, während unterschiedlichen Gesprächen oder zwischen einander kaum bekannten Menschen. Um diese Distanz also sowohl qualitativ wertvoll – und damit einer physischen Nähe ähnlicher – zu gestalten, als auch passgenau in den eigenen Organisationsrhythmus einzuspeisen, braucht es vor allem eines: die Fähigkeit zur Selektion.
In Onlinedating-Portalen wird diese Fähigkeit zunächst per Wisch-Logik gefördert: Profile, die ich mag, wische ich auf dem Handy-Display nach rechts, wer aus meinem Sichtfeld verschwinden soll, wird nach links gewischt. Das Wischen wirkt so weniger wie ein häuslicher Putzvorgang, sondern dient vielmehr der Bewusstwerdung meiner Außenperspektive. Was dann folgt, ist ein – nicht selten taktisches – Spiel der Unterhaltungsversuche, die bestenfalls in ein Date jenseits des Bildschirms münden. Dabei wird betont, was man sich im Idealfall auch von der ‚echten‘ Kontaktaufnahme erhofft: Lockeres, selbstsicheres und kreatives Ich trifft auf ein engagiertes, aktives Anderes. Wie bei einem online bestellten Artikel kann dann beim ersten Treffen beurteilt werden, ob die Lieferung passt oder zu sehr vom digitalen Angebot abweicht.
Umgekehrt, und im ‚realen‘ Leben angekommen, greifen Paare gerne auf den Bildschirm zurück, wenn Kilometer oder Terminkalender die gemeinsame Zeit ihrer Beziehung schmälern. Instant Message und Touch Screen scheinen dabei zu helfen, die unmittelbare Nähe zum Display-Date herzustellen, das via Skype oder FaceTime stattfindet. Wer sich hier verabredet, muss nicht extra Zeit und Geld für Transportmittel und gemeinsame Unternehmungen aufbringen, sondern kann den richtigen Zeitpunkt im eigenen Arbeitstag wählen, überall dort, wo die Internetverbindung gut genug ist.
Momente der Nähe werden durch die digitale Kommunikation nicht nur hergestellt, sondern zudem mit bestimmten Selektionsstrategien aufgewertet. Wenn im Chat Fotos verschickt oder im Dating-Profil ganz bestimmte Aspekte der Persönlichkeit hervorgehoben werden, dann handelt es sich nicht nur um das Teilen von Intimität, sondern genauso um die Inszenierung dessen, was in einem bestimmten Moment als besonders wertvoll erachtet wird. Kontaktmomente verlassen so die Sphäre des nicht steuerbaren Zufalls, der über das eigene Handeln hereinbricht und können selbst das Unvorhersehbare – etwa ein unerwartetes ‚Match’ – wie einen guten Wein reifen lassen und veredelt zurückgeben, zum Beispiel mit einem besonders einfallsreichen Einstieg in den Chat. Nähe, ein Grundbestandteil von engen Beziehungen, wird im Digitalen dementsprechend durch ein Arrangement von Akteuren, Zeit, Medium (Gerät und Applikation) und Handlung (Nutzung) erzeugt. Gewinnen Beziehungen also durch die Tätigkeit des Kuratierens (das im Lateinischen – curare – bedeutet, sich um jemanden zu sorgen, zu kümmern) zunehmend an Nähe und Qualität? Wenn dem so ist, dann stellt sich notwendigerweise die Frage, wer sie kuratiert – und mit welchen Konsequenzen.
Zunächst scheint es wichtig, nicht jeden Auswahlprozess als kuratorischen Akt zu bezeichnen – sonst wäre die Partnerwahl prinzipiell ein kuratorisches Unterfangen. Das Schlagwort ‚kuratiert’ wird derzeit häufig als Gütesiegel und Heilsversprechen verwendet. Kuratieren heißt hier, im nicht enden wollenden Newsfeed oder der unüberschaubaren Produktpalette eine Selektion in Aussicht zu stellen. Dabei verweist der Begriff längst nicht mehr nur ins Reich von Kunst und Kultur, sondern gilt im Allgemeinen als professionalisierte Geste, die entweder von einer namhaften, einzigartigen Persönlichkeit ausgeführt wird, oder aber von ihr handelt (bestenfalls beides). ‚Kuratiert’ deutet somit nicht auf eine beliebige Zusammenstellung hin, sondern es wird die individuelle Inszenierung hinsichtlich der Öffentlichkeitswirksamkeit mitgedacht. Nur wie kann im Nahbereich der Liebe von öffentlichen Aufführungen gesprochen werden?
Wer mir einen verstohlenen Blick zuwirft bleibt im Verborgenen. Postet die gleiche Person jedoch einen zwinkernden Smiley mit rosa Herz unter mein Bild auf Instagram, wird mir damit ihre digitale Identität zugänglich gemacht, sofern sie es nicht ohnehin schon ist. Herz und Smiley stehen dabei nur selten für spontane Gefühlsausbrüche, sondern für wohl überlegte Gesten, die bearbeitet und kommentiert werden können – und die vor allem als gespeicherter Inhalt für alle sichtbar sind und bleiben, die mein Profil betrachten. Sie erzählen nicht nur von einer Nähe zwischen uns, die Herzchen erlaubt, sondern auch von der Handschrift individueller Profilpflege, die mit jedem Post vorgenommen wird. Beziehungen kuratorisch zu gestalten heißt also immer, dabei auch sich selbst als Gestalter*in präsent zu machen und aufzuwerten.
Eine Liebesbeziehung unter digitalen Bedingungen zu führen, bedeutet jedoch nicht zwangsläufig, sie in eine virtuelle Welt der Pixel auszulagern. Auf Instagram Herzen zu posten, kann eine fast natürliche Begleiterscheinung aller tatsächlich ausgesprochenen Liebesbekundungen einer Beziehung sein – und das Ausbleiben jener Herzen das Zeichen einer ohnehin bestehenden Krise. Digitalität weist auf mediale Lebensbedingungen hin, die sich schon vor der massentauglichen Nutzung des Smartphones entwickelt haben. Bestehende soziale Transformationsprozesse paarten sich mit neuen Technologien, die das Schaffen von Verbindungen zwischen Menschen, Dingen und Plattformen zum Motor haben. Laut dem Kulturwissenschaftler Felix Stalder kann Digitalität als ein „Set von Relationen“[2] definiert werden, das sich innerhalb eines Netzwerks digitaler Produkt- und Handlungs-Strukturen entfaltet.
Nicht nur Online-Dating gehört so in den Intimbereich des Digitalen, sondern jedwede Liebesbeziehung, die wesentlich mit digitalen Netzwerken und Geräten in Verbindung steht – oder von ihnen beeinflusst wird, wenn Fernbeziehungen über Skype aufrecht erhalten werden oder ein Wiederholen der ersten gemeinsamen Nacht über gemeinsame Event-Besuche auf Facebook in die Wege geleitet wird. Relationalität – das komplexe Zusammenspiel verschiedener Beziehungen – ist ebenso ein Grundprinzip des Kuratorischen, man denke an das Gefüge von Ausstellung, Kunstwerk, Künstler*in, Kurator*in und Publikum. Entscheidend ist in Kunst- wie Netzwelt dabei immer der Kontext, der geschaffen wird. So stellen nicht nur auf Whatsapp verschickte Fotos mit jedem Bild einen Zusammenhang zwischen allein und gemeinsam verbrachter Zeit auf speziell arrangierte Weise her, auch das Markieren von Partner*innen in Profilbildern auf Facebook demonstriert Zugehörigkeit zu einem vielleicht witzig, romantisch oder abenteuerlich anmutenden Kontext: der eigenen Beziehung. Kuratieren heißt jedoch nicht nur, dass etwas kombiniert und kontextualisiert wird, sondern es stellt zugleich eine öffentliche Inszenierung dar.
Im Digitalen gibt es nicht mehr die Öffentlichkeit als geschlossene Einheit, sondern eine Vielzahl von personalisierten Öffentlichkeiten.[3] Zudem verbindet sich in der Internetöffentlichkeit scheinbar Privates mit dem Öffentlichen. Schein hat hier längst eine eigene ‚Echtheit‘ erlangt – denn digitales Handeln hat auch Konsequenzen für den analogen Raum,[4] und soziale Modelle wie eine „Hinterbühne“[5], auf der die öffentliche Rolle auch einmal abgelegt werden kann, scheinen in Anbetracht der immer transparenter werdenden Kommunikationswelt nicht mehr zu greifen.
Auf der anderen Seite wird dadurch auch das bloße Zuschauen obsolet: Allgegenwärtige Online-Dienste wie Facebook oder Google verstehen User*innen nicht als Publikum, sondern als Teilnehmer*innen, als Material für all jene Daten-basierten Prozesse, die dem Auge verborgen bleiben. Wo sich das Beziehungsleben großteilig auf Online-Plattformen und Chats abspielt, findet dies grundsätzlich über mediale Formen der Darstellung, auf der Bühne einer privaten Öffentlichkeit statt, deren Sichtbarkeitsdimensionen je nach Teilnahme variieren.
Auf dieser Bühne eine Liebesbeziehung zu führen, stellt zum einen wegen der Ambivalenz der eigenen Relation zum Netz eine Herausforderung dar – denn wer Plattformen und Chats nutzt, gestaltet sie durch die eigenen Inhalte auch mit. Zum anderen ist der Kontext, den jede Liebesbeziehung schafft, eingebettet in ein Netzwerk aus Applikationen und Onlineplattformen. Dieses Gewebe aus allerlei datenbasierten und algorithmisch verknüpften Akteuren nennt der Philosoph Timothy Morton „Hyper-Objetcs“[6]: ein nicht zu überblickendes Netz aus menschlichen und nicht menschlichen Knotenpunkten. Zwischen Daten-Cloud, Web-Server, Followern und Chatfenstern den konkreten und beständigen Kontext einer Beziehung herzustellen, ist dementsprechend per se eine Kombination verschiedener Nutzungs-Ebenen. Vor allem aber ist das Kuratieren, also die bewusst aufeinander abgestimmte und sichtbar gemachte Auswahl dieser Ebenen, hier unmöglich als autonome Entscheidung der Liebenden zu werten. Ein unüberschaubares Netzwerk kuratiert sie gewissermaßen algorithmisch mit.
Das Versprechen einer kuratierten Beziehung, nämlich die gemeinsame ‚quality time’, wird letztendlich uneinlösbar, wenn man bedenkt, dass kuratorische Akte immer Momente der Inszenierung sind. Sie folgen so zwar einer spezifischen Vorstellung des Arrangements, weichen aber im Moment ihrer Aufführung notgedrungen davon ab, da Handlungsmomente immer unterschiedlich, flüchtig und nie ganz kontrollierbar sind. So kann der Video-Anruf via FaceTime an einer schlechten Verbindung scheitern, mein extra für die Handykamera aufgelegtes Make-Up verpixelt übertragen werden oder das gepostete Bild eines frisch verliebten Pärchens im Newsfeed der Freunde und Follower als kaum beachtet untergehen. Und beim tatsächlich stattfindenden Date kann trotz des Abgleichs von gemeinsamen Interessen und intimer Chats eine Atmosphäre gegenseitiger Fremdheit herrschen.
Das permanente Performen von User*innen als Profile, in Chats und mit Bildmaterial erzeugt schließlich zwar eine möglichst einzigartige und kreative Form der Präsenz, lässt diese aber auch zur professionalisierten Geste in semi-privaten Öffentlichkeitsstrukturen werden.[7] Die Algorithmizität des Digitalen macht außerdem auch den intimsten Chat auf formeller Ebene zum automatisierten Verfahren der Entscheidung. Hier kuratorisch zu handeln verspricht weder das perfekte ‚Match’, noch das ideale Setting für Liebe. Dass dieses kuratorische Vorgehen aufgrund seines Aufführungscharakters letztlich immer etwas anderes zutage treten lässt als die vorab geschaffene Vision, muss jedoch nur im ersten Moment bedauert werden. Tatsächlich kommt in der Abweichung, dieser uneinlösbaren Hoffnung auf gelenkte Qualität das Intimste, Präsenteste und Liebevollste zum Vorschein, was kuratierte Beziehungen dennoch erzeugen: ein Moment aufgehobener Kontrolle.
Anmerkungen
[1] Vgl. Eva Illouz: Gefühle in Zeiten des Kapitalismus. Frankfurt a. M. 2006.
[2] Felix Stalder: Kultur der Digitalität. Frankfurt a.M.: Suhrkamp 2016, S. 18.
[3] Vgl. Oliver Hahn / Ralf Hohlfeld, / Thomas Knieper (Hg.): Digitale Öffentlichkeiten. Konstanz und München 2015, 11.
[4] Im Sinne des Thomas-Theorems (aufgestellt 1928 von William Isaac Thomas) hat menschliches Handeln reale Konsequenzen, auch wenn die das Handeln verursachende Situation als irreal definiert wurde: „If men define situations as real, they are real in their consequences“.
[5] Vgl. Erving Goffman: War alle spielen Theater. München 1969.
[6] Zitiert von Christopher Kulendran Thomas: ART & COMMERCE: Ecology Beyond Spectatorship, 2014. http://dismagazine.com/discussion/59883/art-commerce-ecology-beyond-spectatorship/ (letzter Zugriff: 23.11.2017).
[7] Vgl. Sven Lütticken: General Performance. In: e-flux journal 31 (Januar 2012), http://www.e-flux.com/journal/31/68212/general-performance/ (letzter Zugriff: 23.11.2017).
Agnieszka Roguski lebt als freie Autorin und Kuratorin in Berlin. Sie promoviert an der FU Berlin über Modi des Öffentlich Werdens unter digitalen Bedingungen und ist assoziiert am DFG Graduiertenkolleg „Das fotografische Dispositiv“ an der HBK Braunschweig.